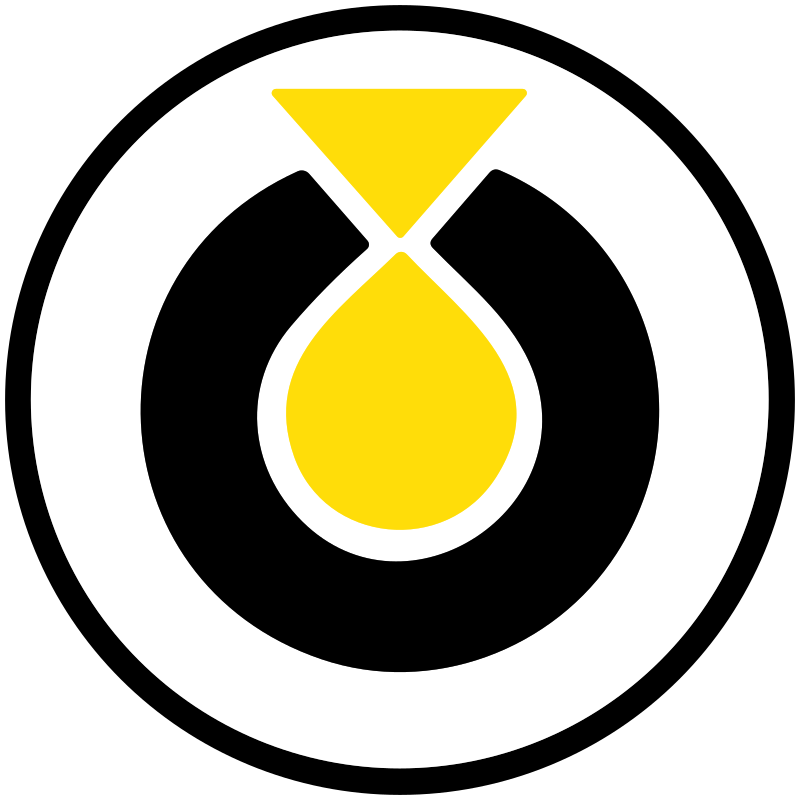Wir werden immer mehr.
Bis zum Jahr 2086 werden 10,2 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Laut dem IDOS (German Institute of Development and Sustainability) entfallen auf Städte nur zwei Prozent der Erdoberfläche. In diesen wohnen heute bereits über 50 Prozent der Weltbevölkerung. Bis 2030 werden voraussichtlich 60 Prozent aller Menschen in Städten leben und bis zum Jahr 2050 sogar mehr als zwei Drittel. Besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern wächst die städtische Bevölkerung stark an. Wir müssen bewusst entscheiden, wie wir damit umgehen. Die zentralen Fragen dabei lauten: Wie kann man eine nachhaltige und lebenswerte urbane Entwicklung gestalten? Wie schafft man Infrastrukturen und stellt beispielsweise die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für die wachsenden Einwohnerzahlen sicher? Ein vielversprechender Lösungsansatz sind sogenannte Smart Cities und Smart Urban Areas. Sie sollen mit vernetzten, digitalen Infrastrukturen die wachsende Urbanisierung effizient, ressourcenschonend und sozialverträglich ermöglichen. Städte sind jedoch für einen sehr großen Teil der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich und der Umweltschutz stellt deswegen eine riesige Herausforderung dar. Sie haben einen hohen Flächen- und Ressourcenverbrauch. In vielen Fällen kann die Infrastruktur in wachsenden Städten nicht mit der steigenden Bevölkerungsdichte Schritt halten. Dies kann zu Ressourcenknappheit, sozialen Konflikten, hoher Umweltverschmutzung und der Bildung von Slums führen.
Wasser ist in vielen Regionen der Welt eine knappe Ressource. Dies gilt nicht nur für die Länder Asiens und Afrikas, sondern zunehmend auch für Europa und die USA. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen sind gegenwärtig rund 785 Millionen Menschen von akuter Wasserknappheit betroffen – Tendenz steigend. Ihnen fehlt der Zugang zu einer elementaren Trinkwasserversorgung und zu sanitären Anlagen. Etwa 70 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs entfällt jedoch auf die Landwirtschaft. Das bedeutet: Ohne Wasser keine Nahrungsmittel. Der Klimawandel verschärft dieses Problem zusätzlich: Die globale Erwärmung führt vermehrt zu extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen und Dürren. Betroffen sind davon vor allem Regionen, die bereits unter Wasserknappheit leiden. Sie geraten zusätzlich unter Druck, da keine zuverlässige Wasserversorgung gewährleistet werden kann. Industriestaaten sind hiervon genauso betroffen wie Schwellen- oder Entwicklungsländer. Dort stehen Landwirte vor besonders großen Herausforderungen: Sie müssen mit wenig Wasser und schlechten Böden Nahrungsmittel anbauen. Doch wegen der zunehmenden Wasserknappheit schrumpft die Anbaufläche, auf der das wirtschaftlich sinnvoll möglich wäre. Hinzu kommt: Viele Agrarbewässerungsanlagen sind ineffizient, was dazu führt, dass sie mehr Wasser verbrauchen als nötig oder es sogar im Boden verloren geht. Globalisierung kann auch hier in Zukunft entscheidend helfen. Nach ihrer klassischen Definition hat sie einen großen Einfluss auf verschiedene Bereiche unseres Alltags, wie unsere Kommunikation und die Waren, die wir kaufen. Globalisierung ist der Prozess, bei dem Länder und ihre Volkswirtschaften durch Handel, Technologie, Kommunikation und kulturellen Austausch immer stärker miteinander verbunden werden.
Durch Globalisierung können Waren, Dienstleistungen, Informationen und Menschen weltweit schneller und einfacher bewegt werden. Dies führt zu einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit, aber auch zu Herausforderungen wie Arbeitsplatzverlagerungen und kulturellen Anpassungen. Genau so kann aber auch ein themenspezifischer Wissenstransfer oder die Beschäftigung internationaler Unternehmen eine Konsequenz sein. So können europäische Firmen beispielsweise moderne Wasserversorgungsanlagen und Pumpen in weniger gut ausgestattete oder arme Regionen bringen, um die Versorgung dort zu fördern oder idealerweise zu sichern. Die Menschen müssen sich dem Klimawandel bewusst sein.
Die Bekämpfung erfordert einen vielschichtigen Ansatz. So können moderne Technologien und Innovationen den Energieverbrauch erheblich senken. Umso wichtiger ist dieser Aspekt, da in der Zukunft eine Energieknappheit drohen wird. Verstärkte Investitionen in erneuerbare Energiequellen wie Wind, Solar und Wasserkraft verringern die Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen. Auch Wasserstoff mit seiner umweltfreundlichen Produktion wird einer der zukunftsträchtigsten Energieträger sein. Ein Mix dieser nachhaltigen Energien wird definitiv die fossilen Quellen ablösen.
Auch die immer intensiveren Forschungen hinsichtlich der Abscheidung von CO2, trägt in Zukunft zu einer deutlichen Schonung unserer Umwelt bei. Die Forschung führt hier aktuell zu immer mehr technologischen Durchbrüchen und durch internationale Forschungskooperationen können Ressourcen effektiv genutzt und Lösungen schneller verbreitet werden. Ein koordinierter internationaler Ansatz, der durch Abkommen, Partnerschaften und gemeinsame Forschung gestützt wird, ist unerlässlich, um globalen Herausforderungen zu begegnen. Die Zusammenarbeit ermöglicht den Austausch von Best Practices, Technologietransfer und gemeinsame Finanzierungsmechanismen. Bildungsprogramme und die Aufnahme der Thematik in Lehrpläne sowie die mediale Debatte sollen das Klimabewusstsein stärken und die Menschen motivieren, sowohl individuell als auch kollektiv aktiv zu werden.
Weltweit haben verschiedene staatliche Institutionen und nicht-staatliche Organisationen Initiativen ins Leben gerufen, die das Bewusstsein für den Klimawandel schärfen und konkrete Maßnahmen fördern. Ein Beispiel: die SDG Action Days der Vereinten Nationen, die Vertreter aus den Mitgliedsstaaten, darunter auch Staats- und Regierungschefs), der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor, der Wissenschaft, lokalen und regionalen Behörden, der Jugend und vielen anderen zusammen bringt und so die Möglichkeit für eine Einbeziehung und Engagement aller Beteiligten schafft. Sie sollen mit verschiedenen Aktionen auf der ganzen Welt die Ziele für nachhaltige Entwicklung erlebbar machen, Menschen sensibilisieren und motivieren. Besonderen Fokus legen die sie auf Bildung und die Bedeutung von Partnerschaften für nachhaltige Lösungen globaler Herausforderungen. Zudem betonen sie auch die Rolle von Gemeinschaften und lokalen Stakeholdern in der Umsetzung. In verschiedenen Veranstaltungen, Workshops und interaktiven Sessions können Teilnehmende Best Practices austauschen, Netzwerke bilden und gemeinsame Lösungen entwickeln. Darüber hinaus dienen sie als Plattform für Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (beispielsweise PETA, der WWF oder Amnesty International), Unternehmen und Bürger. Dieses internationale Engagement steht beispielhaft für kollektive Verantwortung. Solche globalen Kooperationen für eine nachhaltige Zukunft bieten großes Potenzial für die Entwicklung weltweit umsetzbarer Lösungen.
Politische Maßnahmen allein reichen allerdings nicht aus. Unternehmen weltweit erkennen zunehmend ihre soziale Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel. Von der Überarbeitung ihrer Lieferketten bis hin zur Einführung von umweltfreundlichen Produktionsmethoden sind sie zum Teil verpflichtet, nachhaltige Geschäftspraktiken zu verfolgen und sich für den Klimaschutz einzusetzen. Wer aber in diesen Pflichten die Chancen für innovative Lösungen erkennt, kann sich langfristig echte Wettbewerbsvorteile sichern. Sie tragen nicht nur erheblich zum globalen CO2-Ausstoß bei, sondern besitzen die Ressourcen und die Innovationskraft, mit denen sich nachhaltige Veränderungen vorantreiben lassen. Die ökologischen und ökonomischen Vorteile von klimafreundlichen Geschäftsmodellen sind mittlerweile vielfach nachgewiesen. Viele Unternehmen engagieren sich bereits in Initiativen und Projekten, die den Klimaschutz unterstützen, und setzen Standards in ihrer jeweiligen Branche. Dazu zählen Investitionen in erneuerbare Energien, die Entwicklung nachhaltiger Produkte und die Reduktion des eigenen CO2-Fußabdrucks. Als Vorbild- und Brückenfunktion zwischen Verbrauchern, Politik und anderen gesellschaftlichen Akteuren können Unternehmen durch Kooperationen und Allianzen mit Nichtregierungsorganisationen, Bildungseinrichtungen und auch untereinander ihre Reichweite und ihren Einfluss nutzen und das Bewusstsein für den Klimaschutz in der gesamten Gesellschaft erhöhen.
Für eine ganzheitliche, gesellschaftsübergreifende Antwort auf den Klimawandel ist das Engagement wirtschaftlicher Akteure unerlässlich.
Und hier kommen Schmierstoffhersteller wie Völkel ins Spiel.
Gerade so umweltsensible Produkte wie unsere stehen im besonderen Fokus. Nichtsdestotrotz werden sie von allen Unternehmen in allen Branchen gebraucht, die etwas nutzen oder herstellen, was sich in irgendeiner Art bewegt. Ob Drehen, Ziehen oder Drücken – vollkommen egal was sich bewegt, reibungslos tribologisch versorgt muss wirtschaftlich profitabel und umweltfreundlich sein!
Wir haben dafür bereits in den vergangenen Jahren qualitativ hochwertige und umweltverträgliche Spezialschmierstoffe entwickelt, die sich allen spezifischen Anforderungen anpassen und überall bedenkenlos einsetzbar sind.
Der überwiegende Teil unserer Produkte ist beispielsweise frei von PFAS, den sogenannten „Ewigkeitschemikalien“, die sich nur sehr schwer und langsam abbauen und zur Zeit so stark in die Kritik geraten sind. Wir haben für besonders sensible Bereiche, aber auch explizit biologisch abbaubare Schmierstoffe in unserem Portfolio.
Wir selbst sind seit 2023 CO2-neutral zertifiziert und in unserem Handeln sowie unserer gesamten Wertschöpfungskette auf strikte Nachhaltigkeit bedacht. Während der Entwicklung neuer Produkte werden die Rohstoffe hinsichtlich Umweltaspekten, Versorgungssicherheit und Ressourcenschonung ganzheitlich beurteilt. Bestehende Produkte werden wiederkehrend auf nachhaltige Kriterien geprüft und gegebenenfalls modifiziert. Zertifizieren lassen haben wir uns dies bereits vor langer Zeit durch den weltweit akzeptierten und angewendeten Standard DIN EN ISO 14001.